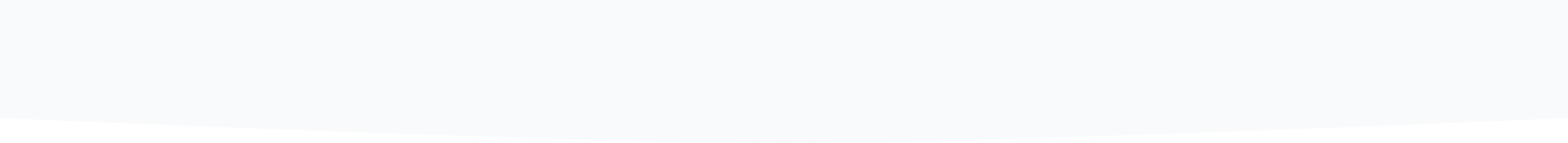Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat heute den „Denkort der Demokratie“ im Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg besucht. Begrüßt wurde sie von Dr. Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG), Carola Niklas, Baureferentin bei der STSG, Dr. Anke Költsch, Kulturvermittlerin bei der STSG, Katja Fischer, Programm- und Projektleiterin bei der IBA Thüringen, und Reinhard Rach, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie e. V. Göring-Eckart besichtigte den durch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA Thüringen) teilsanierten nördlichen Bereich des Hauptgebäudes, der zwei Veranstaltungsräume umfasst – den Denkort der Demokratie.
Beim Rundgang ging es nicht nur um die Vergangenheit des Hauptgebäudes, das unter den Nationalsozialisten zum Reichsgästehaus umgebaut werden sollte, und die Baumaßnahmen im Rahmen des IBA-Projekts. Im Mittelpunkt stand die Zukunft des Hauptgebäudes der ehemaligen Stammburg der Grafen und Fürsten von Schwarzburg. Derzeit entwickelt die STSG zusammen mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora das Schloss zum außerschulischen Lernort weiter.
Warum Schloss Schwarzburg sich dafür anbietet, erklärte STSG-Direktorin Fischer während des Rundgangs: „Im Ahnen- und Emporensaal wird Geschichte greifbar. Die Spuren herausgerissener Wände aus den 1940er Jahren stehen neben barocken Stuckfragmenten und Kritzeleien aus der Nachkriegszeit. Im Rahmen des IBA-Projekts konnten wir die ersten beiden Räume des Hauptgebäudes nach Jahrzehnten wieder nutzbar machen und zugleich die sinnlich erfahrbaren Spuren der Zeit an Wänden und Decken bewahren. Auf den ersten Blick ungewöhnlich, erzählt das Hauptgebäude so heute seine eigene Geschichte. Sie bildet die Geschichte Deutschlands greifbar ab. Das möchten wir auch Schülerinnen und Schülern vermitteln und sind sehr froh, dass wir dabei von einem erfahrenen Partner wie der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora unterstützt werden.“
Katrin Göring-Eckardt unterstrich die besondere Bedeutung des Vorhabens: „Der Denkort der Demokratie birgt eine große Chance, abstrakte Zusammenhänge anschaulich zu machen. Es geht um Geschichte und was wir für Demokratie und Gesellschaft aus ihr lernen können. Einen so wichtigen Identifikationsort in der Region wie Schloss Schwarzburg zum außerschulischen Lernort weiterzuentwickeln, hat deshalb besonderes Gewicht. Es ist eben nicht nur ein eindrucksvolles Schloss, das man am Sonntagnachmittag mit Gästen besichtigt, sondern hier hat Geschichte vor der Haustür tiefe Spuren hinterlassen. Es provoziert und regt zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an.“ Bei Ihrem Besuch kündigte Katrin Göring-Eckardt an, eine Schülergruppe aus der Region ins politische Berlin einzuladen, um Demokratie hautnah zu erleben.
Die Weiterentwicklung von Schloss Schwarzburg zum außerschulischen Lernort gehört zu den durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien geförderten Projekten im Programm SchlösserWelt Digital & Original der STSG. Um junge Menschen an der Mitgestaltung des Lernorts zu beteiligen, war bereits eine erste Schülergruppe vor Ort. Im Sommer folgt zu diesem Zweck eine Jugendfreizeit in Kooperation mit der Volkshochschule Weimar. Als Zeuge der Zeit erzählt das Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg eine ungewöhnliche Geschichte mit vielen Berührungspunkten zu wichtigen Ereignissen der Deutschen Geschichte von der Monarchie über die Weimarer Republik bis zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Teilsanierung des 1942 als Bauruine zurückgelassenen Gebäudes war ein komplexes Vorhaben. Neben anspruchsvollen statischen Maßnahmen galt es die Spuren der Zeit von der Frühen Neuzeit über die Zerstörung bis in die jüngste Gegenwart zu erhalten.
Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms I (SIP I) der STSG – jeweils zur Hälfte gefördert durch Bund und Land – werden derzeit zudem die barrierearme Erschließung des Hauptgebäudes mit dem Einbau eines Aufzugs und der Ausbau eines Servicebereichs vorbereitet. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes stehen damit zukünftig ein Besucherzentrum und Sanitäranlagen zur Verfügung, die das Besuchserlebnis verbessern und den Veranstaltungsbetrieb erleichtern.
Durch Umbaumaßnahmen unter den Nationalsozialisten war in den 1940er Jahren die Stammburg der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt schwer geschädigt worden. Die Sicherung des stark zerstörten und über Jahrzehnte verfallenen Hauptgebäudes begann 2010. Zuletzt konnte die STSG im Rahmen der IBA Thüringen, gefördert durch das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, bis 2021 die ersten beiden Räume im Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg wieder nutzbar machen. Als Schaubaustelle konnten Besucherinnen und Besucher die Baufortschritte im Rahmen des IBA Projektes mit einem Audiowalk an den Wochenenden mitverfolgen. Als weiteres IBA-Projekt entstand bis 2022 mit dem Digitalen Gästebuch ein interaktives Vermittlungsmodul mit zwei Medienstationen im Emporensaal. Ein wichtiger Partner in der Vermittlung ist der Förderverein Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie e.V., der auch mit zahlreichen Spendenprojekten die STSG beim Erhalt der Schlossanlage unterstützt.
Abbildung: Katrin Göring-Eckardt (Mi), Katja Fischer von der IBA Thüringen (l.) und STSG-Direktorin Dr. Doris Fischer (3. v.l.) mit Mitarbeiterinnen der STSG und Mitgliedern des Fördervereins Schloss Schwarzburg e.V., Foto: Tabea Engelke