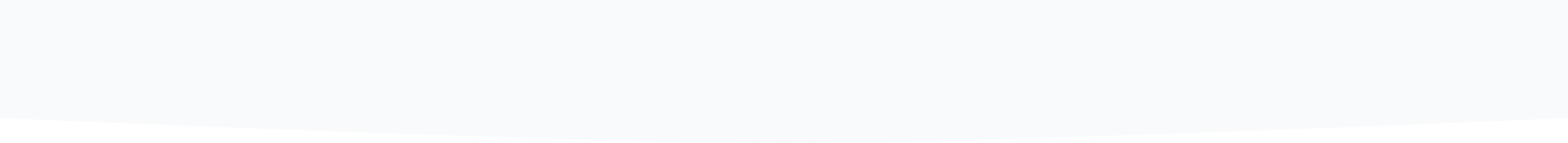Im Fürstlich Greizer Park hat ein neuer Parkverwalter die Arbeit aufgenommen. Der 35-jährige Gärtnermeister Mario Männel leitet seit Anfang Juni das örtliche Team der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Er hatte bereits seine Ausbildung im Park absolviert und kehrt nun mit führender Aufgabe in das bedeutende Gartendenkmal zurück.
„Für mich ist das eine ganz große Sache“, kommentiert Mario Männel seinen Schritt zurück in den Fürstlich Greizer Park. „Als Greizer hat mich der Park von klein auf begleitet, das Bewusstsein für das bedeutende Gartendenkmal ist in der Stadtbevölkerung sehr präsent. Deshalb bin ich wirklich stolz, mit dieser Aufgabe betraut zu werden.“
Mit seinem gemessen an den Aufgaben kleinen Team von fünf Gärtnerinnen und Gärtnern unterschiedlicher Spezialisierung und einer Saisonkraft ist Männel nun verantwortlich für die Pflege des 43 Hektar großen Gartenkunstwerks in der Elsteraue. „Ich bin herzlich aufgenommen worden in einem eingespielten Team. Die gute Atmosphäre spiegelt sich im Pflegezustand. Man sieht dem Park an, dass engagierte und fähige Leute dahinter stehen, die Lust auf ihre Arbeit haben“, schildert Männel seine Eindrücke. Immerhin ein Drittel seiner Zeit kann er derzeit mit dem Team im Freien arbeiten, das ist ihm wichtig. Er weiß aber auch: „Die Büroarbeit ist entscheidend für die reibungslosen Abläufe. Nur wenn Material vorrätig ist, Pflanzungen vorausgeplant werden, Dienstpläne erstellt sind und vieles mehr, können alle ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechend arbeiten.“
Wenn er vom Park spricht, kommt Männel ins Schwärmen: „Die herausragende Schönheit, der man im Park im Großen und im Kleinen begegnet, erfüllt mein Herz.“ Nach seiner Lehre hat er zunächst etwa zehn Jahre lang bei einer Hausmeisterfirma als Mann fürs Grüne gearbeitet und nebenberuflich den Meisterbrief im Garten- und Landschaftsbau erworben. Zuletzt war er beim städtischen Bauhof in Greiz angestellt. „Mit dem Schritt zurück ins Denkmal schließt sich für mich ein Kreis“, freut sich Mario Männel nun. Und das auch persönlich: „Zwei Kollegen waren schon während meiner Ausbildung hier und haben mir damals viel beigebracht, nun treffen wir uns in anderen Rollen wieder.“
Abbildung: Parkverwalter Mario Männel beim Pflegen der kleinen Buchsbaumhecken im Pleasureground des Fürstlich Greizer Parks, Foto: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Sabine Döhla