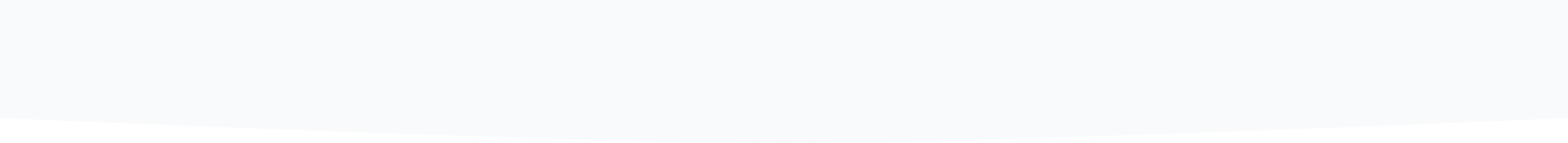Im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein soll ein weiteres Kleinod wiederhergestellt werden – die Greifenbank. Sie gehört zum Ensemble des Blumenkorbfelsens, einem der reizvollen kleinen Architekturensembles, die den Schlosspark in besonderer Weise auszeichnen. Die Wiederherstellung soll großenteils mit Spendenmitteln geschehen.
Der Blumenkorbfelsen entstand in den Jahren 1802/03. Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen ließ das Ensemble zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Charlotte Amalie errichten. Dazu nutzte er eine 18 Meter hohe Felsnadel, deren Spitze eine kleine begehbare Plattform mit großem steinernem Blumenkorb erhielt. Am Fuß des Felsens entstand unter einer grottenartigen Wölbung die Greifenbank mit einer Büste Charlotte Amalies auf der Rückenlehne. Etwa zeitgleich wurden im Park auch andere Kleinarchitekturen errichtet, etwa die Ritterkapelle, das Chinesische Häuschen und die Teufelsbrücke.
Vorbild für die Altensteiner Greifenbank waren antike Bänke in Pompeji, um 1800 ein beliebtes Reiseziel europäischer Adeliger. So wurden halbrunde Steinbänke mit Greifen an den Wangen zu beliebten Ausstattungsstücken in Landschaftsgärten nördlich der Alpen. Herzog Georg I. nutzte das Motiv im antiken Sinn als Erinnerungsort.
Als Material für Blumenkorb und Greifenbank kam Sandstein zum Einsatz. Starke Feuchtigkeit am schattigen Standort führte zur starken Erosion der klassizistischen Bank. Heute sind nur noch etwa zwei Drittel der ursprünglichen Substanz vorhanden. Die Büste Charlotte Amalies wurde bereits vor längerer Zeit sichergestellt und ist heute im Hofmarschallamt zu sehen.
Um das Ensemble zu restaurieren, muss die irreparable Greifenbank als Kopie neu entstehen. Aufgrund der starken Verluste insbesondere am steinbildhauerischen Schmuck waren dafür aufwendige Vorarbeiten nötig. Anhand eines Modells im Maßstab 1:1 wurden die Greifenfiguren, Reliefs und Profile erarbeitet. Als Vorlagen dienten dem eigens beauftragten Bildhauer dokumentierende Zeichnungen aus den 1960er Jahren und historische Fotografien. Außerdem war der Blick auf ähnliche Kunstwerke der Zeit um 1800 hilfreich. Originalvorlagen gab es nicht – Zeichnungen des Meininger Hofbildhauers Christian Müller konnten nicht ermittelt werden.
Das Modell aus Styropor und Gips ist nun bereit zur Umsetzung in Sandstein. Dazu sind insgesamt rund 95.000 Euro notwendig. Sie sollen aus Spenden finanziert werden. Der Förderverein Altenstein-Glücksbrunn e.V. hat bereits 25.000 Euro für das Projekt überwiesen und damit die Vorarbeiten ermöglicht. Er sammelt aktiv weiter. Auch die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen hat die Greifenbank zu einem ihrer Hilfsprojekte gemacht. Gemeinsam mit diesen Partnern freut sich die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten über jede Unterstützung für das Projekt. Bis zur Umsetzung kann das Modell der Greifenbank in einem kleinen Präsentationsraum im Tordurchgang des Hofmarschallamts besichtigt werden.
Spendenkonto der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten:
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
IBAN: DE62 8208 0000 0611 8999 00
BIC: DRESDEFF827
Stichwort: Greifenbank Altenstein