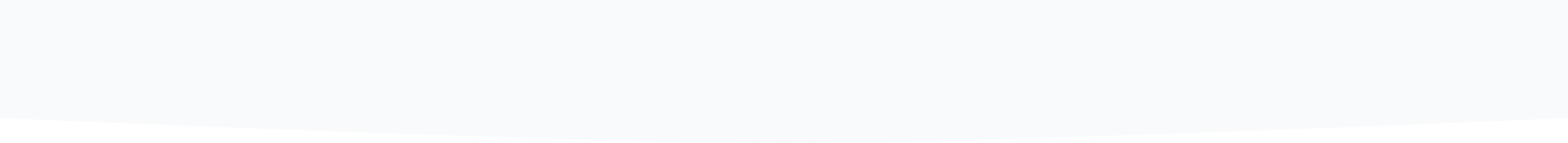Dass in Mildenfurth bei Wünschendorf einmal eine große Klosterkirche stand, sieht man nicht auf den ersten Blick – wurde doch der romanische Sakralbau im 16. Jahrhundert zu einem Schloss umgebaut und dabei teilweise abgerissen. Nun macht sich das bundesgeförderte Projekt „WIR! – KulturLebensRaumVogtland – Zeitreise“ auf den Weg, das mittelalterliche Kloster virtuell erlebbar zu machen. Ziel ist ein aufwendiges digitales Modell, das mithilfe von 3-D-Brillen beim Besuch der Anlage betrachtet werden kann. Läuft alles nach Plan, kann im Herbst 2024 ein Ergebnis präsentiert werden.
Unter dem Motto „Die Welt von gestern sehen und das Heute verstehen“ haben sich mehrere Projektpartner zusammengefunden, um auf innovative Weise das komplexe Baudenkmal Kloster Mildenfurth zu vermitteln. Unter Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung arbeiten dafür die Barbarossa-Stiftung, Prof. Dr. Christoph Fasbender von der Technischen Universität Chemnitz, der E. Reinhold Verlag und die fokus Leipzig GmbH zusammen, assoziierte Partner sind die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) als Eigentümerin von Kloster Mildenfurth und das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA).
„Es geht im Projekt darum, anhand eines besonders spannenden und erklärungsbedürftigen Baudenkmals zu erproben, was digitale Technologien auf der Grundlage einer breit angelegten Forschung für die erlebnishafte Vermittlung von sinnstiftenden Kulturdenkmalen leisten können“, sagt Dr. Klaus-Jürgen Kamprad, Vorstandsvorsitzender der Barbarossa-Stiftung. STSG-Direktorin Dr. Doris Fischer betont: „Das Projekt ist eine einmalige Gelegenheit, unsere über viele Jahre gesammelten Ergebnisse der Bauforschung in ein Angebot zu gießen, das die Vielzahl von abstrakten Details und Fakten sinnlich erfahrbar macht. Ich bin sehr gespannt auf das Modell und danke den Projektpartnern, dass sie das Potential des vielleicht eigentümlichsten unserer Denkmale erkannt haben und mit uns an der Vermittlung arbeiten wollen.“
Auf der Grundlage umfangreicher Bauforschungen am Gebäude selbst und in schriftlichen und bildlichen Quellen, aber auch mithilfe eines detaillierten Aufmaßes und hochauflösenden Fotografien soll ein digitales Modell entstehen. Mit den 3-D-Brillen ausgestattet, können Besucher dann virtuell den Zustand der Klosterkirche wahlweise im frühen 14. oder im frühen 16. Jahrhundert – also kurz vor dem Umbau zum Schloss – wahrnehmen.
Abbildungen:
– Kloster Mildenfurth, Foto: STSG, Constantin Beyer