Im Schlosspark Wilhelmsthal ist der Parksee wieder in der Funktion zu erleben, für die er vor mehr als 300 Jahren angelegt wurde – als zentrales Element des Gartenkunstwerks. Die Sanierung des Staudamms ist abgeschlossen. Sie war notwendig, weil der See im rechtlichen Sinn eine Talsperre ist, der Damm jedoch den damit verbundenen Anforderungen nicht entsprach. Gemeinsam mit ihren Partnern konnte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) eine Sanierung umsetzen, die dem Denkmal und den Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Rund 1,75 Millionen Euro wurden investiert, 360.000 Euro davon für die Wiederherstellung der Sckell-Brücke neben dem Damm. Im Betrieb der Anlage wird die STSG nun durch die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) unterstützt.

2009 übernahm die STSG Schloss und Park Wilhelmsthal in ihren Bestand. Den See betrachtete sie zunächst aus der Perspektive des Gartendenkmals. Im Barock, später im Landschaftsgarten war der See wichtiger gestalterischer Bezugspunkt und Lichtreflektor. Diese Wirkung zu erhalten, ist ein wichtiges Ziel. Hinzu kam aber eine für eine Denkmalinstitution ungewöhnliche Herausforderung: Der See gehört zur Talsperrenklasse 2. Mit dem Eigentum am See ist deshalb die Verpflichtung zum Betrieb und zur Instandhaltung der Stauanlage nach der geltenden DIN 19700 verbunden. Von behördlicher Seite kamen bald Hinweise auf den Sanierungsbedarf.

Die Anforderungen des Denkmalschutzes und der Talsperrentechnik sind nicht immer leicht zu vereinbaren. Entsprechend erforderten die Maßnahmen einen Spagat zwischen der wirksamen und technisch regelkonformen Sanierung des Staudamms einerseits und denkmalpflegerischen Aspekten andererseits. Mit individuellen Lösungen konnte dabei einiges ermöglicht werden, etwa die Bepflanzung von Teilbereichen des Damms nach historischen Quellen, die Bewahrung der äußeren Ansicht und die Einbindung der historischen Sckell-Brücke mit Wasserfall.
Von 2015 bis 2020 wurde der acht Meter hohe Erddamm mit zwei Grundablässen und einer Hochwasserentlastung saniert. Am 1. Februar 2021 begann unter Begleitung durch die TFW der Probestau der sanierten Anlage und erreichte in der zweiten Februarwoche mit dem Wintereinbruch den Beginn des vierwöchigen Vollstaus. Unter Eis und Schnee wurde die sanierte Anlage erfolgreich betrieben.

Die Partnerschaft der TFW und der STSG geht über die Begleitung des Probestaus hinaus. Für das Jahr 2021 sind wöchentliche Überwachungszyklen der Stauanlage vereinbart sowie die jährliche Anlagenbegehung und die Erstellung des Eigenüberwachungsberichtes durch die TFW. Seit dem Frühjahr ist die Anlage im Regelbetrieb und letzte Pflanzarbeiten wurden umgesetzt. Nach Vorlage des Abschlussberichtes zum Probestau wird die Genehmigung zur Inbetriebnahme der Stauanlage durch die Aufsichtsbehörde erwartet.
Die TFW ist ein fachlich versierter Partner für die STSG, zu deren Kernaufgaben der Betrieb von Talsperren nicht gehört. Die TFW hingegen ist hier Profi. Sie vereint als Anstalt des öffentlichen Rechts hoheitliche und gewerbliche Aufgaben der Wasserversorgung. Unter anderem unterhält und betreut sie 120 Stauanlagen in Thüringen, darunter sechs versorgungswirksame Trinkwassertalsperren, die rund 55 Prozent des Trinkwassers in Thüringen liefern.
Fotos: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Franz Nagel

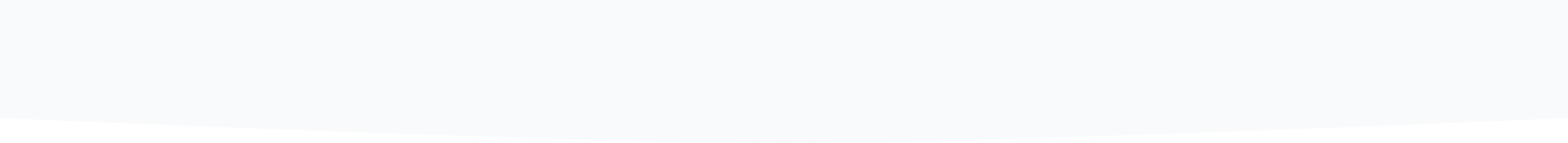






 Abbildungen: Präsentation des Werks „Ein Gartentheater für den Altenstein“ am 22. Juni, Fotos: STSG, Franz Nagel
Abbildungen: Präsentation des Werks „Ein Gartentheater für den Altenstein“ am 22. Juni, Fotos: STSG, Franz Nagel







