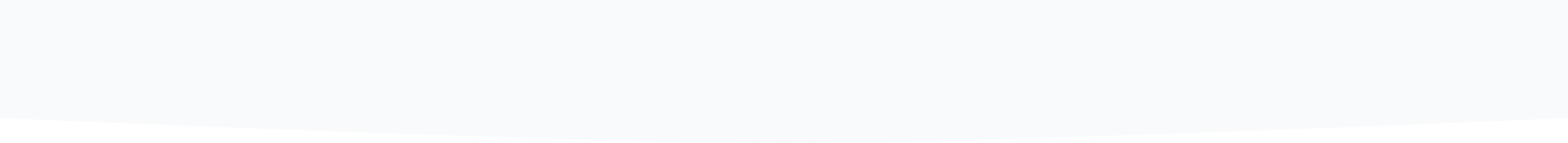In Vorbereitung auf die Bundesgartenschau 2021 (BUGA21) wird die ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul auf dem Erfurter Petersberg in großem Umfang teilsaniert. Im Inneren wird während der Laufzeit der BUGA21 die Ausstellung „Paradiesgärten – Gartenparadiese“ präsentiert. Thema der Ausstellung sind Werke der Gartenkunst in Thüringen vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Ausgangspunkt ist das Paradies – der in der Bibel beschriebene Garten Eden – als Urform des Gartens.
Am Beispiel der Gartenanlagen des untergegangenen Klosters St. Peter und Paul, von dem heute nur noch die Peterskirche steht, wird die mittelalterliche Gartenkultur behandelt. Die Außenanlagen des Klosters umfassten den Garten im Kreuzgang, Obst-, Gemüse-, Kräuter- und Weingärten sowie den Friedhof.
Während im Mittelalter die Klöster bei der Förderung und Verbreitung der Gartenkultur führend waren, übernahmen die Fürstenhöfe seit der frühen Neuzeit diese Rolle. An den historischen Gärten und Parks in der Obhut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist diese Entwicklung ablesbar. Im Gegensatz zu den mittelalterlichen Gärten sind die Park- und Gartenanlagen der Renaissance, des Barock und die Landschaftsgärten in ihrem Bestand erhalten und in ihrer Vielfalt und Schönheit erlebbar. Die Ausstellung vermittelt Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte, Gestaltungsweise und in das Wirken der Gartendenkmalpflege, das die Voraussetzung zum Erhalt dieser wertvollen Kulturgüter bildet.
Zu diesen Gartenparadiesen gehört der in der Renaissance entstandene Garten von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, einer der frühesten Terrassengärten in Deutschland mit den Überresten einer ehemals bedeutenden Wasserkunst.
Von barocker Pracht zeugen die erhaltenen Skulpturen des Schlossparks Molsdorf. Da ihre Originalstandorte nicht bekannt sind, wurden einige in einem gärtnerisch spannungsreich gestalteten Lapidarium am Schloss neu aufgestellt.
Zur kostbaren Ausstattung eines Barockgartens gehörten Orangeriegebäude, die Zitruspflanzen und andere exotische Gewächse beherbergten. Im Garten von Schloss Schwarzburg ist die Orangerie mit dem Kaisersaal und dem Orangerieparterre zugleich ein Statussymbol in Verbindung mit der Standeserhöhung des Hauses Schwarzburg-Rudolstadt im Jahr 1710.
Schloss Friedenstein verfügt nicht nur über großzügige Orangerie- und Gewächshausanlagen, sondern auch über einen der frühesten Landschaftsgärten in Deutschland. Die 1769 begonnene Komposition des englischen Gärtners Haverfield mit sanft geschwungenen Wasserflächen, Inseln und Buchten entfaltet heute noch ihre malerische Wirkung.
Der weitläufige Park Altenstein zeichnet sich durch seine beeindruckenden Inszenierungen der felsigen Landschaft aus der Zeit um 1800 aus. Staffagebauten, wie das chinesische Häuschen oder die Ritterkapelle, krönen schlanke Felsnadeln und eröffnen vielfältige Ausblicke in die Parklandschaft.
Von der herausragenden landschaftlichen Lage profitieren auch die Dornburger Schlösser. Sie wurden durch die Gartenanlagen von Carl August Christian Sckell ab 1824 zu einer Einheit verbunden. An der Gestaltung hatten auch Großherzog Carl August und Goethe regen Anteil.
Die Gartenkultur besaß einen hohen Stellenwert und die Fürsten selbst widmeten sich dieser Kunst. So auch Ludwig Friedrich II. von Schwarzburg-Rudolstadt, von dem sogar Entwurfszeichnungen des Terrassengartens von Schloss Heidecksburg überliefert sind.
Zu den bedeutendsten deutschen Gartenkünstlern zählt Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Gemeinsam mit Hermann Jäger gestaltete er ab 1853 den Park von Schloss Wilhelmsthal um. Über Jahrzehnte vernachlässigt, wird die Anlage nun von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten nach den Richtlinien der Gartendenkmalpflege wiederhergestellt und auf diese Weise ein Werk Pücklers zurückgewonnen.
Über einen einzigartigen Gehölzbestand verfügt der Greizer Park. Das hier schon früh begonnene Pinetum – eine Sammlung von Nadelgehölzen – wird in Abstimmung auf die historische Konzeption durch gezielte Nachpflanzungen ergänzt und für die Zukunft erhalten.
Als exotische Pflanze und prachtvolle Frucht war die Ananas äußerst begehrt. Im Park von Schloss Sondershausen gelang ihre gärtnerisch anspruchsvolle und aufwändige Kultur über einen langen Zeitraum bis ins 19. Jahrhundert.
Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wuchs das Interesse an Gartenkunst und Botanik auch bei den Bürgern. Der Garten am Kirms-Krackow-Haus veranschaulicht diese Entwicklung. Hier entstand ab 1750 ein privates Paradies mit reichem Blumenschmuck und vielfältigen Obstsorten.
Auch die Peterskirche besaß ein Paradies. Als „paradiso“ wurde in den lateinischen Quellen die einst vorhandene Vorkirche bezeichnet, durch die man im Mittelalter in die Kirche gelangte. Die Peterskirche ist nicht nur Ausstellungsgebäude, sondern in ihrer hohen künstlerischen Qualität und kulturhistorischen Bedeutung auch ein Hauptexponat der Ausstellung. Auf ihre Geschichte, ihre Architektur, die wertvollen Wandmalereien und die Sanierung wird in der Ausstellung eingegangen. Die Architektur der Peterskirche umschließt die in der Ausstellung präsentierten Gärten wie die Einfriedung eines Gartens. Daraus erschließt sich das Leitbild der Ausstellung: der Hortus conclusus (lat. geschlossener Garten).