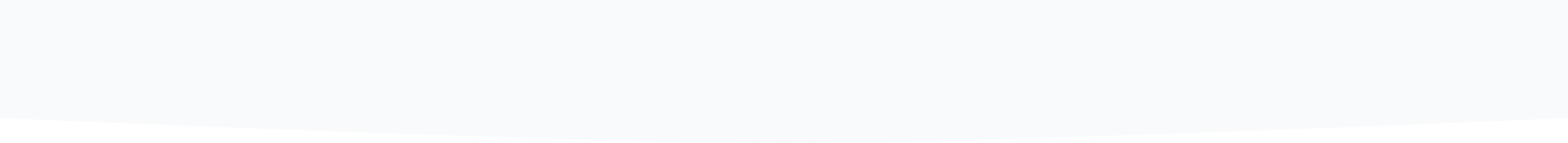Im Fürstlich Greizer Park hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) die Entschlammung des rund 8 Hektar großen Parksees abgeschlossen. Der letzte Schlamm wurde heute symbolisch mit Schaufeln aus dem abgelassenen Parkseebett ausgehoben. Als nächstes werden Ufer saniert und 60 Bäume nachgepflanzt. Im Herbst wird der See wieder befüllt. Gut 3,3 Millionen Euro kostet die Parksee-Revitalisierung, gefördert vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit 3 Millionen Euro und das Land Thüringen mit 330.000 Euro.
Dr. Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, freut sich über den Meilenstein: „Der Parksee gehört zu den zentralen Gestaltungselementen des historischen Gartendenkmals und hat zugleich eine große ökologische Bedeutung. Die Entschlammung war dringend nötig, damit der See diese beiden Funktionen weiter erfüllen kann. Das ist nur dank der umfangreichen Förderung vom Bund und Land möglich geworden, dafür sind wir sehr dankbar.“
Über 15.000 Tonnen entwässerter Schlamm wurden binnen eines Jahres durch die beauftragte Firma abtransportiert. Der Schlamm wurde zunächst per Amphibienfahrzeug mit einem Saugrüssel aus dem See gepumpt und mit Schwimmschläuchen zu einer Aufbereitungsanlage am Nordufer befördert. Dort wurde ihm das Wasser entzogen und wieder in den See geleitet. Die Schlammpellets wurden zu einer Deponie abtransportiert. Ende 2024 wurde dann das Wasser abgelassen, per Bagger wurden die ufernahen Bereiche entschlammt. In den nächsten Schritten stehen jetzt noch die Sanierung von geschädigten Uferabschnitten, Nachpflanzungen von 30 Bäumen am Ufer und der Lückenschluss in der Seufzerallee mit 30 Linden-Nachpflanzungen an.
Auch STSG-Gartenreferent Dietger Hagner ist zufrieden mit dem Fortgang des Projekts: „Die Parksee-Revitalisierung ist das größte Projekt, das wir in einem Gartendenkmal der STSG bisher umgesetzt haben. Und es geht reibungslos voran, die Zielgerade ist bereits in Sicht. Die Entschlammung war der größte und für das Gleichgewicht des Sees entscheidende Teil, immerhin haben wir das Wasservolumen wieder fast verdoppelt. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der beauftragten Firma vor Ort, die auch bei Hitze, Regen und Kälte unermüdlich an der Mammutaufgabe die Schlammablagerungen in dem mehrere Hektar umfassenden Parksee abzutragen gearbeitet haben. Jetzt starten wir direkt mit der Ufersanierung.“
Die Entschlammung dient dem ökologischen Gleichgewicht des Parksees. Über die vergangenen Jahrzehnte hatte sich im Parksee so viel Sediment und Pflanzenmaterial angesammelt, dass er etwa die Hälfte seiner ursprünglichen Tiefe verlor. Durch das geringe Wasservolumen erhöhte sich die Anfälligkeit für Temperaturschwankungen. Außerdem reicherten sich Nährstoffe an, was beispielsweise Blaualgenbefall begünstigte. Der See konnte Umwelteinflüsse und Temperaturschwankungen weniger gut abfedern und die Gefahr des sogenannten Umkippens stieg. Dieses Problem wird mit der Entschlammung deutlich verringert, wohl erstmals seit 150 Jahren.
Joachim Beiler vom Auftragnehmer Verbiro GmbH sowie Parkverwalter Mario Männel, Gartenreferent Dietger Hagner und Bauabteilungsleiterin Silvia Wagner von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (v.l.n.r.) mit den letzten Eimern Schlamm aus dem Parksee, Foto: STSG, Franz Nagel