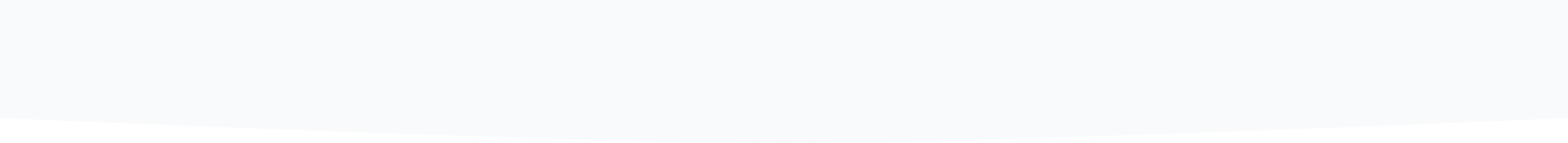Seit einigen Jahren werden die Folgen des Klimawandels in historischen Parks und Gärten deutlich sichtbar. Die Auswirkungen von Trockenheit, Hitze, Stürmen und Starkregen auf jahrhundertealte Kulturschätze sind gravierend. Am 28. September 2024 macht die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen (AGDS) erstmals mit einem bundesweiten Aktionstag darauf aufmerksam. Alle großen staatlichen Schlösserverwaltungen beteiligen sich mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, bei dem Probleme und Lösungsstrategien in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist mit Angeboten in mehreren Gartendenkmalen dabei.
Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) bietet am Aktionstag kostenfreie Expertenführungen in fünf bedeutenden Gartendenkmalen an, die auf unterschiedliche Wiese von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Im Fürstlich Greizer Park führt um 10 Uhr Parkverwalter Mario Männel zum Thema „Klimawandelfolgen im Fürstlich Greizer Park – Schäden und Maßnahmen“ (Treffpunkt Parkeingang/Blumenuhr). Im windexponierten Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein zeigt Parkverwalter Toni Kepper um 10.30 Uhr Klimaschäden im Schloss- und Landschaftspark Altenstein und berichtet über Schadensbeseitigung und Strategien zur Nachpflanzung (Treffpunkt Besucherzentrum). Der Herzogliche Park Gotha ist von anhaltenden Trockenperioden besonders betroffen. Dort führt um 10.30 Uhr Parkverwalter Jens Scheffler unter dem Titel „Fünf nach Zwölf – Veränderungen des Klimas und ihre Auswirkungen auf die historische Parkanlage von Schloss Friedenstein Gotha“ (Treffpunkt Herzogliches Museum). In den Dornburger Schlossgärten bei Jena demonstriert Gartenverwalter Frank Bergmann um 10 Uhr den Aufbau eines nachhaltigen Bewässerungsmanagements für die terrassierte Gartenanlage (Treffpunkt Brunnen vor dem Renaissanceschloss). Im Schlosspark Molsdorf im Süden von Erfurt informiert Gartenreferent Jonathan Simon über die Auswirkungen des Klimawandels auf Vegetation und Gartengewässer (Treffpunkt Schloss, Gartenseite).
In vielen historischen Gartenanlagen in ganz Deutschland werden an diesem Tag Themenführungen, Workshops und Vorträge angeboten. So wird es beispielsweise um artenreiche Wildblumenwiesen und den Erhalt von uralten Baumriesen gehen, Besucherinnen und Besucher können Baumkontrolleuren bei Ihrer Arbeit über die Schulter blicken, neues zu Wassermanagement, klimaangepasster Pflanzenanzucht und standortangepassten Baumschulen erfahren. Im Zentrum steht die Frage: Wie werden die historischen Parkwälder in stabile Ökosysteme umgebaut und welche Lösungsansätze geben Hoffnung für die Zukunft? Das vollständige landesweite Veranstaltungsprogramm sowie eine umfangreiche, illustrierte Broschüre zum Thema unter www.klimaanpassung-gartendenkmal.de
Der Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf historische Gartendenkmäler. Daher stehen die Schlösserverwaltungen vor der elementaren gärtnerischen, denkmalpflegerischen und ökologischen Herausforderung, herausragende Meisterwerke der Gartenkunst – darunter die berühmten UNESCO-Welterbeparks in Potsdam-Sanssouci, Weimar, Wörlitz, Kassel-Wilhelmshöhe, Brühl und Bad Muskau/Łęknica – nicht nur authentisch, sondern auch widerstandsfähig für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund führte die AGDS bereits in den vergangenen Jahren ein deutschlandweites Forschungsprojekt durch, das Erfahrungswissen der Gärtnerinnen und Gärtner zur Klimaanpassung mit Erkenntnissen von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft zusammengeführt und aufbereitet hat. Die Ergebnisse des Projekts wurden im Juni 2024 bei einer Abschlusstagung in Bad Muskau der Presse vorgestellt und auf der Projektseite klimaanpassung-gartendenkmal.de veröffentlicht. Die Ergebnisse fließen in die praktische Arbeit der Parkpflegeteams ein.
Auf einen Blick
Angebote der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zum Aktionstag Klimawandel in historischen Parks und Gärten
Fürstlich Greizer Park
10 Uhr Führung mit Parkverwalter Mario Männel „Klimawandelfolgen im Fürstlich Greizer Park – Schäden und Maßnahmen“
Treffpunkt Parkeingang/Blumenuhr
Schlosspark Altenstein
10.30 Uhr Führung mit Parkverwalter Toni Kepper „Klimaschäden im Schloss- und Landschaftspark Altenstein: Über den Umgang mit den Schäden bis hin zur Nachpflanzung“
Treffpunkt Besucherzentrum Altenstein
Herzoglicher Park Gotha
10.30 Uhr Führung mit Parkverwalter Jens Scheffler „Fünf nach Zwölf – Veränderungen des Klimas und ihre Auswirkungen auf die historische Parkanlage von Schloss Friedenstein Gotha“
Treffpunkt Herzogliches Museum
Dornburger Schlossgärten
10 Uhr Führung mit Gartenverwalter Frank Bergmann „Nachhaltiges Bewässerungsmanagement“
Treffpunkt Brunnen vor dem Renaissanceschloss
Schlosspark Molsdorf
10 Uhr Führung mit Gartenreferent Jonathan Simon „Klimawandelfolgen im Schlosspark Molsdorf“
Treffpunkt Schloss, Gartenseite
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen, unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet, ist eine auf die Bundesrepublik Deutschland bezogene Vereinigung der in öffentlicher Trägerschaft organisierten Schloss- und Gartenverwaltungen von bundesweiter Bedeutung. Sie versteht sich als gemeinsame Interessensvertretung ihrer Mitglieder und als Forum zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch über deren Aufgaben, Herausforderungen und Möglichkeiten. Die Verwaltungen der ehemals fürstlichen Schlösser und Gärten in Deutschland sind Einrichtungen, die in teils langer Tradition mit dem Ziel weiterer ungebrochener Kontinuität die Aufgaben der Erhaltung, Pflege, Erforschung und Vermittlung einzigartiger Schloss-, Garten- und Parkanlagen von hoher kunsthistorischer, aber auch herausragender geschichtlicher Bedeutung wahrnehmen. In ihrer Einheit aus Architektur und künstlerischer Ausstattung sind die umfänglichen Denkmalensembles prägend für die kulturelle Identität einer Region. Zudem sind sie – jedenfalls, was die Zeit bis 1918 angeht und zum Teil darüber hinaus – Schauplätze deutscher Geschichte. Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen, nehmen die Schlösser- und Gartenverwaltungen die baulichen, konservatorischen, musealen und kommunikativen Aufgaben unter einem spezifisch gesamtheitlichen Ansatz im öffentlichen Interesse wahr. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind derzeit folgende fünfzehn Institutionen: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg; Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen; Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg; Staatliche Schlösser und Gärten Hessen; Hessen Kassel Heritage – Museen, Schlösser, Parks; Staatliche Schlösser und Gärten Mecklenburg-Vorpommern; UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl; Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz; Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH; Kulturstiftung Dessau Wörlitz; Kulturstiftung Sachsen-Anhalt; Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten; Klassik Stiftung Weimar; Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau; Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz. Weiterführende Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen finden Sie unter: www.ag-ds.de
Abbildungen:
– Nachpflanzung nach Baumverlust im Fürstlich Greizer Park, Foto: STSG, Dietger Hagner
– Baumschäden im Herzoglichen Park Gotha, Foto: STSG, Dietger Hagner
– Einbau eines Bewässerungssystems in den Dornburger Schlossgärten, Foto: STSG, Franz Nagel
– Verlust einer Winterlinde im Schlosspark Molsdorf, Foto STSG, Grit Straßburg
– Sturmschäden im Schlosspark Altenstein 2021, Foto: STSG, Toni Kepper