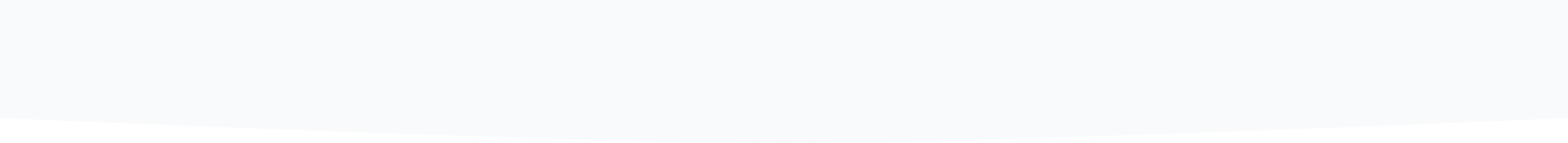Das kulturelle Erbe „Thüringische Residenzenlandschaft“ ist nicht Bestandteil der neuen deutschen Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe. Darüber hat heute die Kultusministerkonferenz der Länder entschieden. Die sogenannte Tentativliste dient in den nächsten Jahren als Grundlage für Vorschläge der Bundesrepublik an das UNESCO-Welterbe-Komitee mit Sitz in Paris. Thüringen hatte sich mit neun Residenzen in acht Residenzstädten dafür beworben, darunter auch eine bayerische Stadt. Das Land und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) sehen dennoch weiter großes Potential in dem Vorhaben und möchten es weiter verfolgen.
Den Antrag auf Aufnahme in die Tentativliste hatte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit einem eigens eingerichteten Welterbe-Kompetenzzentrum im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei erarbeitet. Das Land hatte den Antrag im Oktober 2021 bei der Kultusministerkonferenz eingereicht. Es folgte ein Evaluierungsprozess durch eine Expertenkommission, die alle Vorschläge der Länder prüfte. Nach eingehender Prüfung gab die Kommission Empfehlungen für die neue Tentativliste. Auf dieser Basis haben die zuständigen Minister der Länder die Liste beschlossen.
Thüringens Kulturminister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff: „Die Thüringische Residenzkultur ist in ihrer Vielfalt und Dichte herausragend. Dass unser Vorschlag es nicht auf die Tentativliste geschafft hat, schmälert diesen Wert nicht. Wir hatten und haben gute Gründe, die Thüringische Residenzenlandschaft in die Waagschale zu legen. Sie sind im Antrag überzeugend dargelegt, wofür ich der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit ihrem Welterbe-Kompetenzzentrum danke. In der aktuellen Kandidatenrunde hat es nicht geklappt. Das ändert nichts an meiner Überzeugung, dass das Vorhaben gute Aussichten und einen großen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Die Thüringische Residenzenlandschaft als Zeugnis friedlicher Koexistenz und föderaler Aushandlungsprozesse birgt eine wichtige Botschaft für die Krisen der Gegenwart. Die Denkmale laden zur Auseinandersetzung ein und sind ein wichtiger Baustein nachhaltiger Bildung. Das Land wird deshalb mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten das Projekt weiter verfolgen – auch wenn das bedeutet, dass wir einen längeren Atem haben müssen als zunächst erhofft.“
Dr. Doris Fischer, Direktorin der STSG, schätzt ein: „Natürlich sind wir erst einmal enttäuscht, auch wenn angesichts der aktuell schon 192 Schlösser auf der Welterbeliste immer klar war, dass es knapp wird. Aber wir sind sicher, dass wir für Thüringen einen Schatz heben, der bisher zu Unrecht wenig beachtet wurde. Die Denkmale der Thüringischen Residenzenlandschaft transportieren neben ihrem außerordentlich hohen Grad an materieller Authentizität besondere Werte, die heute bedeutungsvoller sind denn je. Der kulturelle Austausch als Medium der Verständigung auch in Konfliktsituationen ist hier mit Händen greifbar, aber auch die Wege zur Wahrung des Friedens trotz vorhandener Konkurrenzverhältnisse. Deshalb haben sich die Anstrengungen in jedem Fall gelohnt und wir wollen sie fortsetzen. Mit dem Tentativantrag haben wir gezeigt, worin die Einmaligkeit der Thüringischen Residenzenlandschaft besteht. Unser mit Unterstützung durch die Thüringer Staatskanzlei geschaffenes Welterbe-Kompetenzzentrum wird weiter am Ball bleiben. Der Sinn steht für mich außer Zweifel, und schon der bisherige Weg hat positive Effekte gehabt. Dieser Schwung ist eine Chance auch für das Land.“ Fischer dankte in diesem Zusammenhang dem internationalen Expertenbeirat, der die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bei der Erarbeitung des Antrags beriet und begleitete.
Land und STSG prüfen nun gemeinsam den weiteren Weg für das Welterbe-Vorhaben „Thüringische Residenzenlandschaft“. Eine Weiterbearbeitung für die Vorlage in der nächsten Kandidatenrunde steht dabei im Vordergrund. Im zurückliegenden Erarbeitungsprozess haben sich zahlreiche Aspekte ergeben, die durch notwendige Forschungen fruchtbar gemacht werden können. Parallel wird aber auch die Bewerbung um das Europäische Kultursiegel erwogen, dessen Grundidee übergreifende Netzwerke in den Mittelpunkt rückt. Beide Wege können sich ergänzen. Zudem soll das Potential des kulturellen Erbes für außerschulische und schulische Bildung stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Bildung und gesellschaftliche Partizipation spielen im Zusammenhang mit dem UNESCO-Welterbe als Aspekt nachhaltigen Umgangs mit Kulturdenkmalen inzwischen eine zentrale Rolle.
Im Mittelpunkt des 2021 eingereichten Vorschlags „Thüringische Residenzenlandschaft“ stehen neun bis 1918 über Jahrhunderte als Regierungssitze genutzte Residenzschlösser verschiedener Dynastien in acht Residenzstädten. Nirgendwo sonst gibt es eine polyzentrale Residenzenlandschaft auf so engem Raum, die sich in vergleichbarer Kontinuität erhalten hat. Die strukturelle und funktionale Kontinuität ist an den vorgeschlagenen thüringischen Residenzen bis heute ablesbar. Charakteristisch ist die selbstbewusste Integration von Altem in die stetige Erneuerung und Erweiterung der Residenzen. Mittelalterliche Türme, Renaissancebauten, barocke Repräsentationsarchitektur und der Historismus des 19. Jahrhunderts fügen sich zu Bildern gebauter Geschichte. Sie drückten das Alter der Dynastien aus und unterstrichen damit ein wichtiges Argument für die Legitimation fürstlicher Herrschaftsansprüche.
Diese Residenzen bilden den Kern des Antrags: Schloss Heidecksburg in Rudolstadt (Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt), Schloss Sonders-hausen (Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen), das Obere Schloss in Greiz (Fürsten Reuß Älterer Linie) und das direkt benachbarte Untere Schloss (Fürsten Reuß Jüngerer Linie), das Residenzschloss Weimar (Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach), das Residenzschloss Alten-burg (Herzöge von Sachsen-Altenburg), Schloss Friedenstein in Gotha (Herzöge von Sachsen-Gotha), Schloss Elisabethenburg in Meiningen (Herzöge von Sachsen-Meiningen) sowie das seit 1920 zu Bayern gehörende Schloss Ehrenburg in Coburg (Herzöge von Sachsen-Coburg ). Jede Residenz ist wiederum mit zahlreichen weiteren Schlössern im Land verbunden, so mit Sommer- und Jagd- und Lustschlössern wie Witwensitzen.