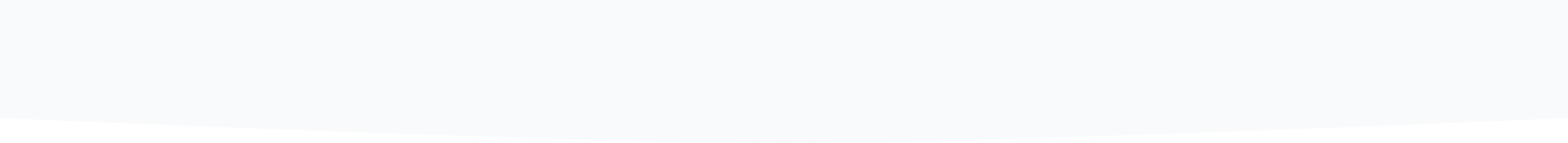2021 hat sich der Freistaat Thüringen mit neun Residenzen in acht Residenzstädten auf den Weg zum Welterbe gemacht. „Thüringische Residenzenlandschaft“ heißt der Antrag, den die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) im Auftrag der Thüringer Landesregierung erarbeitete, begleitet durch einen internationalen Expertenbeirat. Vor zwei Jahren wurde er eingereicht und – ebenso wie die Anträge aus den anderen Bundesländern – von einem Fachgremium geprüft. Die Entscheidung über die Tentativliste werden die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder voraussichtlich in diesem Herbst treffen.
Nun hat die STSG die bisherige Arbeit für das Vorhaben in einem Buch zusammengefasst: „Die Thüringische Residenzenlandschaft auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe. Der erste Schritt zur deutschen Kandidatenliste“. Den druckfrischen Band haben Dr. Doris Fischer, Direktorin der STSG, und die beiden Bearbeiterinnen des Antrags, PD Dr. Astrid Ackermann und Claudia Schönfeld M.A., heute dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow übergeben.
Ministerpräsident Ramelow zeigte sich erfreut über die Publikation: „Schon beim ersten Durchblättern sieht man, welche Bandbreite für ein Welterbe-Vorhaben zu bearbeiten ist. Ich danke der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und dem Expertenbeirat, dass sie vor zwei Jahren in sehr kurzer Zeit einen fundierten Antrag auf die Beine gestellt hat, den wir mit Überzeugung in den Ring werfen konnten. Ganz wesentlich ist auch die große Unterstützung im Land, besonders in den beteiligten Kommunen. Die Residenzenlandschaft ist als bis heute prägendes Thüringer Alleinstellungsmerkmal schon jetzt ein gutes Stück klarer geworden. Wie auch immer die Kultusministerkonferenz demnächst entscheidet, der Ertrag für Thüringen und das Selbstverständnis des Frei-staats ist in jedem Fall groß.“
STSG-Direktorin Fischer erläuterte: „Wir wussten immer um die Besonderheit des Schatzes, den Thüringen mit seinem höfischen Erbe hat. Die Dichte der Residenzen, ihre baulichen Gemeinsamkeiten und die Strahlkraft der eng verflochtenen Hofkulturen sind ein gewichtiges Pfund im internationalen Vergleich. Im Antrag haben wir das deutlich gemacht und konnten dabei auf viele Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen zählen. Eine Essenz dieser geballten Expertise und das Ergebnis einer Tagung haben wir in dem Band zusammengeführt. Wir verstehen ihn als Zwischenstand und zugleich als Startblock für weitere lohnende Anstrengungen. Wenn es der Vorschlag auf die Tentativliste schafft, wartet ein aufwendiger Forschungs- und Arbeitsprozess bis hin zum eigentlichen Antrag an das UNESCO-Welterbekomittee. Wir stehen bereit.“

Im Mittelpunkt des Thüringer Vorschlags stehen neun bis 1918 über Jahrhunderte als Regierungssitze genutzte Residenzschlösser verschiedener Dynastien in acht Residenzstädten. Ihre Dichte ist weltweit einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es eine polyzentrale Residenzenlandschaft auf so engem Raum, die sich in vergleichbarer Kontinuität erhalten hat. Die strukturelle und funktionale Kontinuität ist an den Bauwerken bis heute ablesbar. Charakteristisch ist die selbstbewusste Integration von Altem in die stetige Erneuerung und Erweiterung der Residenzen. Mittelalterliche Türme, Renaissancebauten, barocke Repräsentationsarchitektur und der Historismus des 19. Jahrhunderts fügen sich zu Bildern gebauter Geschichte. Sie drückten das Alter der Dynastien aus und unterstrichen damit ein wichtiges Argument für die Legitimation fürstlicher Herrschaftsansprüche. Und sie machen den von der UNE-SCO-Welterbe-Konvention geforderten „außerordentlichen universellen Wert“ („outstanding universal value“) aus.
Diese Residenzen bilden den Kern des Antrags: Schloss Heidecksburg in Rudolstadt (Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt), Schloss Sondershausen (Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen), das Obere Schloss in Greiz (Fürsten Reuß Älterer Linie) und das direkt benachbarte Untere Schloss (Fürsten Reuß Jüngerer Linie), das Residenzschloss Weimar (Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach), das Residenzschloss Altenburg (Herzöge von Sachsen-Altenburg), Schloss Friedenstein in Gotha (Herzöge von Sachsen-Gotha), Schloss Elisabethenburg in Meiningen (Herzöge von Sachsen-Meiningen) sowie das seit 1920 zu Bayern gehörende Schloss Ehrenburg in Coburg (Herzöge von Sachsen-Coburg ). Jede Residenz ist wiederum mit zahlreichen weiteren Schlössern im Land verbunden, so mit Sommer-, Jagd- und Lustschlössern sowie Witwensitzen.
Foto: STSG-Direktorin Dr. Doris Fischer und die Bearbeiterinnen PD Dr. Astrid Ackermann und Claudia Schönfeld M.A. (v.l.n.r.) übergeben das Buch zum Welterbe-Vorhaben an Ministerpräsident Bodo Ramelow, Foto: TSK