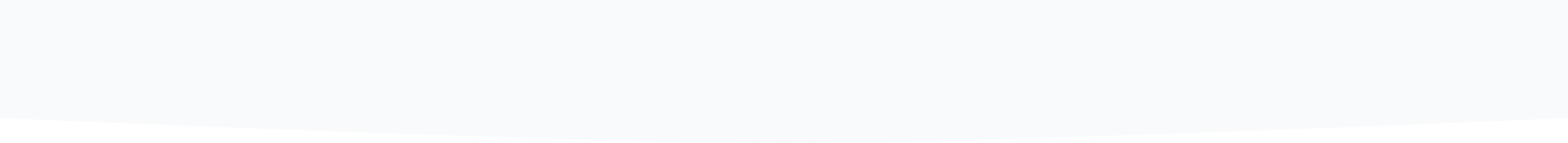Der für den 3. Juni in der Erfurter Peterskirche geplante Vortrag „Mittelalterliche Sonnenuhren an der Peterskirche und um Erfurt“ von Dipl.-Ing. Karsten Grobe muss coronabedingt abgesagt werden. Er war im Rahmen der Vortragsreihe „Erfurter Peterskloster und Thüringer Gartenparadiese“ vorgesehen, die die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten begleitend zur Ausstellung „Paradiesgärten – Gartenparadiese“ aufgelegt hat. Die weiteren Vorträge der Reihe sollen stattfinden, wenn die Pandemiebestimmungen dies zulassen.
Termine aktuell
Vortragsreihe „Erfurter Peterskloster und Thüringer Gartenparadie-se“
Veranstalter: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
jeweils donnerstags 18 Uhr, Klosterkirche St. Peter und Paul
Zutritt nur mit BUGA-Ticket
Änderungen und coronabedingte Ausfälle vorbehalten.
- Juni 2021
Der Peterborn und die Wasserversorgung von Kloster und Zitadelle auf dem Erfurter Petersberg (Dr.-Ing. Dietmar Schmidt)
- Juni 2021
Eine schwierige Liaison. Klöster und Festungen in Kurmainz (Dr. Georg Peter Karn)
- Juni 2021
Gartenkünstler in Thüringen (Dipl.-Ing. Dietger Hagner)
- Juli 2021
Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen an der Peterskirche im Vorfeld der BUGA 2021 (Dipl.-Ing. Arch. Silvia Wagner, Dipl.-Rest. Stephan Scheidemann, Dipl.-Ing. Arch. Frank Spangenberg)
- Juli 2021
Gartendenkmalpflege bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Dipl.-Ing. Dietger Hagner)
- August 2021
Der Petersberg in Erfurt – 750 Jahre Stätte klösterlichen Lebens
(Prof. em. Dr. Mathias Werner)
- September 2021
Die Erfurter Peterskirche – eine Königskirche?
(Dr. Rainer Müller, Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie)
- September 2021
Baugestalt und Ausstattung des Erfurter Petersklosters im Mittelalter. Neueste Forschungsergebnisse
(Tim Erthel M.A.)