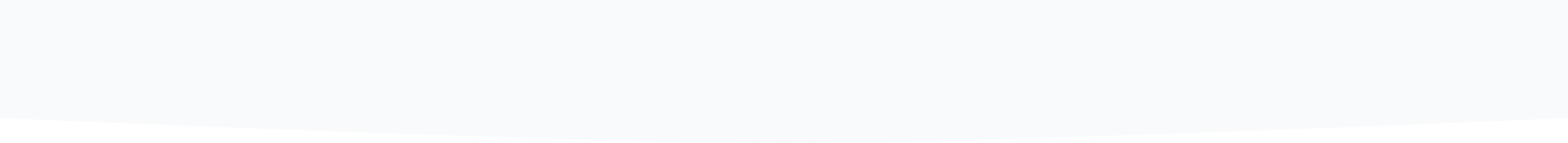Bei der Sanierung des Brunnenhauses auf Schloss Bertholdsburg ist ein entscheidendes Etappenziel erreicht. Die Sanierung von Statik, Fassaden und Dach ist abgeschlossen. Im nächsten Jahr sollen Arbeiten im Innenraum und eine neue Außentreppe das außergewöhnliche Kleinod wieder perfekt machen. Etwas Besonderes ist nicht nur das Gebäude selbst – das Sanierungsprojekt wird zum allergrößten Teil durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz finanziert, die dafür eine private Großspende erhalten hat.
Die Arbeiten an dem kleinen Lustgebäude im Schlossgarten konzentrierten sich zunächst auf die Standsicherheit. Einer der sechs runden Sandsteinpfeiler, auf denen ein Gewölbe und darüber eine sechseckige Turmstube ruhen, musste neu gegründet werden. Seine über Jahrhunderte entstandene Schieflage hatte Risse am Kreuzgratgewölbe nach sich gezogen. Das Gewölbe musste deshalb mit Stahlstiften vernadelt und von oben mit einem Edelstahlgitter mit Mörtelüberzug gefestigt werden. Außerdem sichert ein von außen in die Fugen gelegter Ringanker das Gebäude gegen das Auseinanderdriften.
Neben der neu gewonnenen Stabilität gibt es auch optisch sichtbare Sanierungserfolge. Am Dach wurde nicht nur die Holzkonstruktion saniert, sondern auch die Dachdeckung denkmalgerecht erneuert. Nach historischen Abbildungen und einem erhaltenen Befund wurden kleine Biberschwanzziegel, sogenannte Turmbiber, von einer auf historische Modelle spezialisierten Ziegelei eigens hergestellt. Es handelt sich um Ziegel, die besonders für steile Dächer geeignet sind. Das sechseckige Zeltdach zeigt sich nun wieder in der feingliedrigen Struktur, die es bis ins frühe 20. Jahrhundert auszeichnete.
Besondere Sorgfalt waltete auch an den Sandsteinoberflächen. Steinrestauratoren reinigten die Werksteinflächen von Krusten und Verschmutzungen und festigten sie. Loses Fugenmaterial ersetzten sie durch Mörtel in passender Rezeptur. An einigen Stellen waren auch Steinergänzungen nötig.
Die nun abgeschlossenen Maßnahmen werden von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit 264.000 Euro großzügig gefördert. Darin enthalten ist eine spektakuläre Privatspende in Höhe von gut 250.000 Euro. Weitere 64.000 Euro investiert die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten aus ihrem eigenen Haushalt.
Dr. Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, ist erfreut über die besonderen Förderumstände: „Die Zusammen-arbeit mit den Kollegen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bedeutet für uns, dass denkmalpflegerische Qualität für alle Beteiligten an erster Stelle steht. Die Großzügigkeit eines privaten Spenders hat uns gemeinsam in die Lage versetzt, höchste Maßstäbe anzulegen.“
Auch für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist ein solches Projekt nicht alltäglich. Vorstand Steffen Skudelny erläutert: „Wenn Leidenschaft für das kulturelle Erbe und Mäzenatentum auf ein konkretes Denkmal treffen, ist das ein Glücksfall. Am Brunnenhaus konnten wir deshalb sehr schnell und umfangreich Mittel bereitstellen. So ist es gelungen, eine wirkliche Rarität zu bewahren.“
Kleine Gartenarchitekturen wie das Brunnenhaus gehörten im 16. Jahrhundert zu einer repräsentativen Gartengestaltung. Oft boten sie mit erhöhten Räumen oder Altanen einen Überblick über die geometrisch angelegten Pflanzungen. Allerdings haben sich nur wenige solcher Lustbauten erhalten. Eine Seltenheit ist zudem die Kombination mit dem ebenerdigen Brunnenbecken. Überwölbte Brunnenhäuser finden sich beispielsweise in Kreuzgängen von Klöstern, nur selten handelt es sich um freistehende Gebäude.
Dass man in Schleusingen Altan und Brunnen miteinander kombinierte, könnte mit der Gründungssage Schleusingens zu tun haben. Denn im Brunnenbecken fließen drei Quellen zusammen, und in einem solchen Becken badete der Sage nach eine Wassernixe, als sie einen frühen Grafen von Henneberg um die Rettung ihrer Tochter aus einem Zauberbann bat. Der kam der Bitte nach, heiratete die Tochter und gründete die Burg samt Stadt.
Abbildung: Brunnenhaus mit restaurierten Fassaden und saniertem Dach, Foto: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Katja Hanf